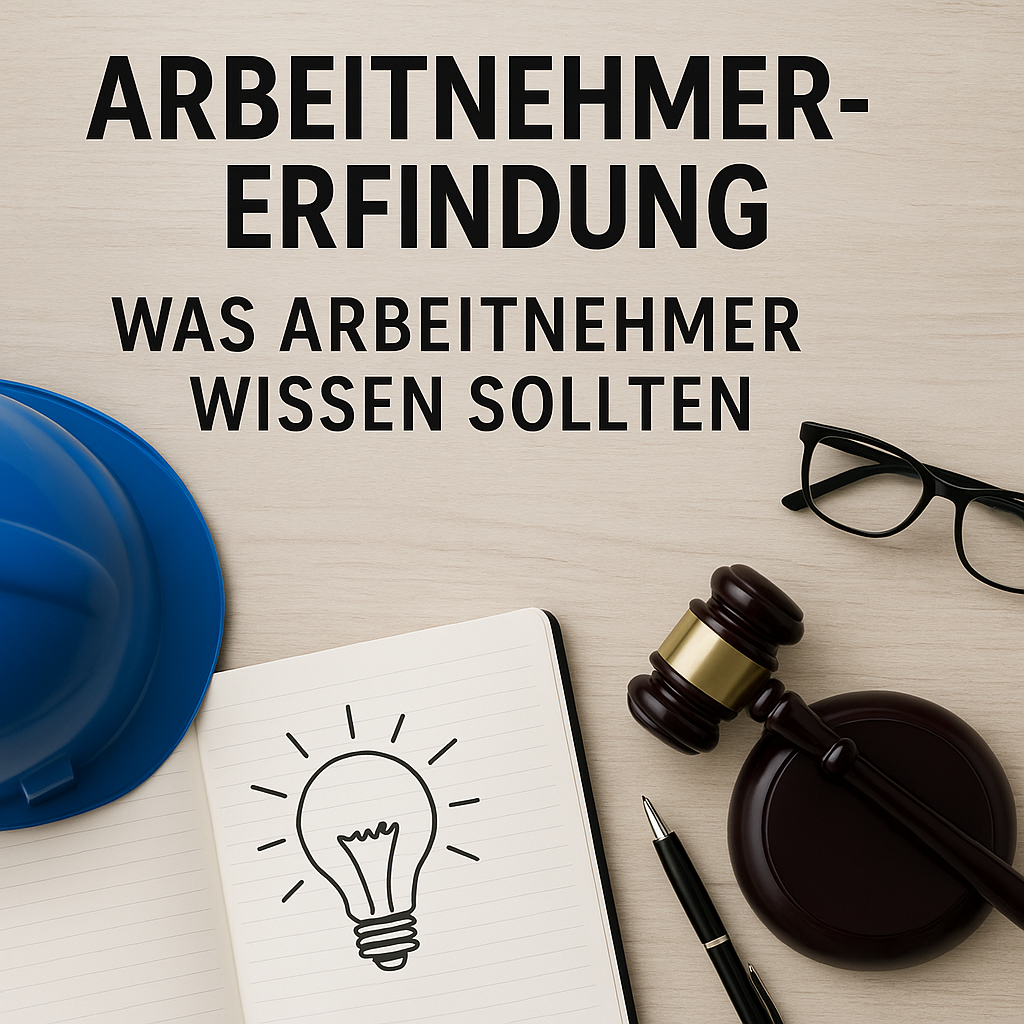Arbeitnehmererfindung: Was Arbeitnehmer wissen sollten
Arbeitnehmererfindung: Was Arbeitnehmer wissen sollten
Viele Arbeitnehmer arbeiten in einem Umfeld, in dem Innovationen und technische Neuerungen zum Alltag gehören. Ingenieure, Entwickler, Forscher oder auch Techniker machen im Rahmen ihrer Tätigkeit Entdeckungen und entwickeln neue Lösungen. Aber wem gehört eine solche Erfindung eigentlich? Gehört sie dem Arbeitnehmer, der sie gemacht hat? Oder dem Arbeitgeber, der die Rahmenbedingungen bereitgestellt hat? Und ganz entscheidend: Haben Arbeitnehmer Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung, wenn ihre Erfindung genutzt oder sogar patentiert wird?
Diese Fragen betreffen viele Arbeitnehmer, die im Bereich Forschung, Entwicklung oder Technik tätig sind – und sie sind keineswegs nur für Großkonzerne relevant. Auch in mittelständischen Unternehmen oder Start-ups kommt es regelmäßig vor, dass Arbeitnehmer Erfindungen machen, die einen erheblichen wirtschaftlichen Wert entfalten können. Das deutsche Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbNErfG) regelt genau diese Fälle und sorgt für einen Ausgleich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Ihr Überblick: Das Wichtigste in Kürze
- Erfindungen von Arbeitnehmern sind im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbNErfG) geregelt.
- Grundsätzlich darf der Arbeitgeber eine Diensterfindung für sich beanspruchen, der Arbeitnehmer hat dafür Anspruch auf eine angemessene Vergütung.
- Jede Diensterfindung muss vom Arbeitnehmer unverzüglich gemeldet werden. Der Arbeitgeber hat anschließend vier Monate Zeit, um zu entscheiden, ob er die Erfindung beansprucht oder freigibt.
- Auch bei Kündigung, Betriebsübergang oder Insolvenz bleiben die Ansprüche aus einer Erfindung bestehen.
- Arbeitnehmer haben immer das Recht, als Erfinder benannt zu werden – unabhängig davon, wer das Patent anmeldet.
- Über die Höhe der Vergütung kommt es häufig zum Streit. Arbeitnehmer haben hier Informations- und Auskunftsrechte, um ihre Ansprüche durchzusetzen.
Inhalt
1. Was gilt überhaupt als Arbeitnehmererfindung?
Das Gesetz unterscheidet zwischen sogenannten Diensterfindungen und freien Erfindungen.
Eine Diensterfindung liegt vor, wenn die Erfindung während des Arbeitsverhältnisses gemacht wurde und in Zusammenhang mit der Tätigkeit oder den betrieblichen Erfahrungen steht. Typisches Beispiel: Ein Ingenieur entwickelt während seiner Arbeit eine neue Produktionsmethode, die direkt im Betrieb genutzt werden kann.
Eine freie Erfindung liegt hingegen dann vor, wenn sie ohne Bezug zur Arbeitstätigkeit des Arbeitnehmers entstanden ist.
Beispiel: Ein Arbeitnehmer arbeitet im Vertrieb, tüftelt aber in seiner Freizeit an einer ganz anderen technischen Lösung, die nichts mit seinem Job zu tun hat. Auch hier gibt es aber Mitteilungs- und Anbietungspflichten: Arbeitnehmer müssen dem Arbeitgeber ihre freie Erfindung melden und ihm gegebenenfalls zuerst anbieten, bevor sie sie selbst vermarkten.
2. Meldepflicht des Arbeitnehmers
Ganz entscheidend ist die Meldepflicht: Wer als Arbeitnehmer eine Diensterfindung macht, muss dies unverzüglich und in Textform seinem Arbeitgeber mitteilen. Das kann auch per E-Mail erfolgen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Eingang der Meldung ebenfalls schriftlich zu bestätigen.
Diese Meldung ist wichtig, weil damit die Fristen zu laufen beginnen. Meldet der Arbeitnehmer seine Erfindung gar nicht oder verspätet, riskiert er, seine Rechte zu verlieren. Umgekehrt hat der Arbeitgeber ab dem Zeitpunkt der Meldung vier Monate Zeit, um zu entscheiden, ob er die Erfindung für sich beanspruchen will oder ob er sie dem Arbeitnehmer freigibt.
3. Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber
Entscheidet sich der Arbeitgeber, die Erfindung zu beanspruchen, gehen alle übertragbaren Rechte an der Erfindung automatisch auf ihn über. Das heißt: Der Arbeitgeber darf die Erfindung nutzen, vermarkten und zum Patent anmelden.
Der Arbeitnehmer verliert damit allerdings nicht alle Rechte: Das sogenannte Recht auf Erfinderbenennung bleibt bestehen. Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer im Patent oder Gebrauchsmuster als Erfinder genannt werden muss. Dieses Recht ist höchstpersönlich, es ist nicht übertragbar und kann auch nicht abgetreten oder abgekauft werden.
4. Welche Vergütung steht Arbeitnehmern zu?
Das Kernstück des Arbeitnehmererfindungsrechts ist die Vergütung. Der Grundgedanke ist einfach: Der Arbeitgeber darf zwar die Erfindung beanspruchen, er muss den Arbeitnehmer dafür aber angemessen vergüten.
Der Anspruch auf Vergütung entsteht bereits mit der Inanspruchnahme der Erfindung, nicht erst mit der Patenterteilung. Das ist wichtig, weil ein Patenterteilungsverfahren Jahre dauern kann.
Die Höhe der Vergütung richtet sich nach dem wirtschaftlichen Wert der Erfindung, dem Anteil des Arbeitnehmers an der Entstehung und der Rolle des Betriebs. Vereinfacht gesagt gilt eine Formel:
Vergütung = Erfindungswert × Anteilsfaktor.
Beispiel: Wenn eine Erfindung dem Arbeitgeber einen wirtschaftlichen Vorteil von einer Million Euro verschafft, und der Anteil des Arbeitnehmers nach den Richtlinien auf 10 % festgelegt wird, ergibt das eine Vergütung von 100.000 Euro.
In der Praxis kommt es hier sehr häufig zu Streit. Deshalb haben Arbeitnehmer ein umfassendes Auskunftsrecht: Sie dürfen Informationen vom Arbeitgeber verlangen, um die Nutzung der Erfindung und den daraus erzielten wirtschaftlichen Vorteil nachvollziehen zu können. Nur so lässt sich die Angemessenheit der Vergütung prüfen.
5. Freie Erfindungen und ihre Grenzen
Auch bei freien Erfindungen gilt: Arbeitnehmer müssen ihren Arbeitgeber informieren, wenn die Erfindung während des Arbeitsverhältnisses entsteht. Der Arbeitgeber kann dann prüfen, ob er ein Interesse daran hat.
Wichtig: Arbeitnehmer dürfen ihre Erfindung nicht einfach selbst verwerten, wenn sie damit in direkte Konkurrenz zum eigenen Arbeitgeber treten würden. Hier greift die Treuepflicht und regelmäßig ein Wettbewerbsverbot aus dem Arbeitsverhältnis. In allen anderen Fällen haben Arbeitnehmer aber ein eigenes Verwertungsrecht.
6. Sonderfälle: Kündigung, Insolvenz, Betriebsübergang
Viele Arbeitnehmer fragen sich, was mit ihren Rechten passiert, wenn das Arbeitsverhältnis endet oder sich die Unternehmensstruktur ändert.
- Kündigung: Wurde die Erfindung während des Arbeitsverhältnisses gemacht, bleiben die Ansprüche auch nach Beendigung bestehen.
- Insolvenz: Geht der Arbeitgeber insolvent, können Ansprüche auf Vergütung auch gegen den Erwerber oder die Insolvenzmasse bestehen.
- Betriebsübergang: Bei einem Betriebsübergang tritt der neue Arbeitgeber grundsätzlich in alle Rechte und Pflichten ein, auch in die aus dem Arbeitnehmererfindungsrecht.
7. Streitigkeiten über die Vergütung
Besonders häufig streiten Arbeitnehmer und Arbeitgeber über die Höhe der Vergütung. Der Gesetzgeber hat deshalb ein besonderes Verfahren vorgesehen: Bevor es zu einer Klage vor Gericht kommt, muss zunächst ein Schiedsstellenverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt durchlaufen werden. Erst wenn dieses Verfahren erfolglos bleibt, ist der Klageweg zu den ordentlichen Gerichten oder – bei reinen Zahlungsklagen – zu den Arbeitsgerichten eröffnet.
Fazit
Arbeitnehmererfindungen sind ein komplexes, aber hochrelevantes Thema. Für viele Arbeitnehmer geht es um erhebliche Summen, wenn ihre Erfindung erfolgreich genutzt oder sogar zum Patent angemeldet wird. Klar ist: Wer eine Erfindung macht, muss sie melden – und hat im Gegenzug Anspruch auf eine angemessene Vergütung und auf die Anerkennung als Erfinder.
Wenn Sie unsicher sind, ob Sie alle Rechte aus Ihrer Erfindung geltend machen können, oder wenn es Streit über die Höhe Ihrer Vergütung gibt, sollten Sie anwaltliche Unterstützung in Anspruch nehmen. Denn: Ihre Ideen sind wertvoll – und Sie haben ein Recht darauf, fair daran beteiligt zu werden.
Kontaktieren Sie uns noch heute:
- Telefon: +4989909015511
- E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. - Unser Chatbot JUPUS: Einfach unten rechts auf Ihrer Bildschirmseite starten.